
LA: Broken promises, broken dreams.
Eines der berühmtesten nicht gehaltenen Versprechen der modernen Radgeschichte ist Lance Armstrong’s „Ich habe nicht gedopt, ehrlich.“ Um diese Art von großen und wichtigen Versprechen geht es hier nicht, es geht um die kleinen, oft unbedacht und schnell ausgeprochenen Verprechen die wir machen wie: „Wir treffen uns dann morgen um 7 Uhr zur Ausfahrt an der Weserbank.“ oder “ Diesen Monat will ich mindestens 1.000 km fahren.“
In der letzten Zeit habe ich mich auf cyclyng.com mehrfach mit der Analyse von einfach zugänglichen Daten aus dem Internet beschäftigt, um daraus Schlüsse auf den Rennradmarkt zu ziehen (Jedermannrennen und Strava Festive 500). Ich finde es faszinierend welche Informationen verfügbar sind und nur darauf warten ausgewertet und interpretiert zu werden. Hier ein weiterer und letzter Teil, der sich mit der Frage beschäftigt, wie viel ein Versprechen unter Rennradfahrern in verschiedenen Ländern wert ist.
Erstens hängt es stark von der Person ab, die ein Versprechen abgibt, wie ernst dies genommen wird und welche Konsequenzen das hat. Nehmen wir mal das erste Beispiel (Morgen um 7 an der Weserbank): Es gibt Menschen, die kommen dann doch nicht zum Treffpunkt um sieben, weil das Wetter schlecht ist, die Form nicht stimmt, die Kinder krank werden, die Frau meckert, oder der Wecker nicht geklingelt hat. Oder weil ohnehin genug Fahrer kommen und sie meinen, auf mich kommt es da auch nicht mehr an. Es gibt dann auch Menschen, die kommen im Regen mit schlechter Form trotz kranker Kinder und meckernder Frau; haben sich in 5 Minuten angezogen weil der Wecker nicht geklingelt hat, weil… ja warum eigentlich? Weil sie das nun einmal versprochen haben, basta, ganz egal was passiert und eine starke innere Verpflichtung fühlen.

Raus oder nicht raus? Das ist hier die Frage.
Zweitens hängt die Einhaltung eines Versprechens davon ab, wem man etwas versprochen hat. Es gibt Personen, die einen erheblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden ausüben können, oder von denen wir abhängig sind. Da überlegen wir uns sehr gut, was wir ihnen versprechen und versuchen dies unbedingt einzuhalten, da sonst mit Sanktionen zu rechnen ist. Es gibt Personen, eigentlich Freunde, die uns nicht mit Sanktionen drohen, deren Freundschaft oder Wertschätzung wir allerdings nicht einfach aufs Spiel setzen wollen. Es gibt, das leichtfertig dahingesagte Versprechen abends beim Bier, von dem wir wissen, dass der andre weiß, dass es wahrscheinlich nicht eingehalten wird.
Als ich da erste Mal länger im Ausland war und viele Amerikaner traf, nahm ich ein „And if you have any problems, just give me a call – I will help you!“ als ein Versprechen wahr, heute weiß ich, dass dies eine Grußformel ist. Die Verpflichtung ein Versprechen „nach außen“ einzuhalten nimmt hier zunehmend ab.
Und dann gibt es die Versprechen, die wir uns selber gegenüber machen; man nennt so etwas auch (gute) Vorsätze, oder ein Versprechen „nach innen“. Hier hängt es von der Person selber ab, wie stark sie sich gebunden fühlt ein Versprechen nach innen einzuhalten. Ich persönlich finde, dass dies auch sehr gut mit Begriff „Disziplin“ beschrieben wird.
Und könnte es nun sein, dass dies nicht nur eine Eigenschaft einer Person ist, sondern generell bei einigen Kulturen (oder der Einfachheit halber hier: in einigen Ländern) stärker oder weniger ausgeprägt ist als in anderen? Dazu muss man zunächst einmal anmerken, dass es hier nicht darum geht, diese Frage moralisch oder nach gut/schlecht Mustern zu bewerten: Ein Versprechen unter allen Umständen zu halten erscheint vielleicht erst einmal generell als eine sehr positive Eigenschaft, aber, sagen wir mal, dem Führer zu versprechen Berlin bis zum letzten Mann zu verteidigen und sich dann daran gebunden zu fühlen ist auch moralisch gesehen falsch.
Kulturdimensionen
Es ist schwierig Kulturen/Länder mit ihrer ganzen Vielfalt und Buntheit einfach zu beschreiben und miteinander zu vergleichen. Um die ganze Sache etwas einfacher zu machen gibt es verschiedene Modelle, von denen das bekannteste, die Kulturdimensionen von Geert Hofstede, einem holländischen Psychologen, Anfang der Siebziger erstellt wurde. Es basiert auf einer Befragung von mehr als 70.000 Angestellten von IBM in über 70 Ländern die zwischen 1967 und 1973 durchgeführt wurde. Hofstede applizierte seine analytische, psychologische Magie auf diese Daten (keiner weiß genau wie) und schwups, kamen dabei zunächst vier, und später noch zwei mehr, Kulturdimensionen heraus deren Ausprägung eine Kultur beschreibt.
Man stelle sich das so vor, als ob man jedes Rennrad dieser Welt anhand von sechs Merkmalen beschreiben kann, zum Beispiel: Gewicht, Preis, Anzahl der Gänge, Rahmengröße, Reifenbreite und Vorbaulänge. Jedes Merkmal kann eine andere Ausprägung (also einen anderen Wert) haben, und deren Kombination ist einzigartig für ein Rennrad bzw. eine Kultur.
Ein Rennrad. Also eine Kultur.
Um mal ein Beispiel zu geben: Die Dimension „Machtdistanz“ beschreibt, inwieweit die Verteilung von Macht in einer Kultur von ihren Mitgliedern akzeptiert wird, oder einfacher ausgerückt, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand etwas tut, nur weil es ihm von seinem Chef gesagt wurde.
Es gibt eine Menge Kritik an diesem Modell: Die Daten seien zu alt, IBM Angestellte sind nicht repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes, es gibt keine Begründung für die Auswahl ausgerechnet dieser Dimensionen etc.; heute ist es sehr schick Hofstede zu attackieren und auf die Unzulänglichkeiten seiner Forschung hinzuweisen. Andere Forscher haben andere Modelle entwickelt, die das ganze noch etwas komplizierter beschreiben und somit vielleicht zutreffender sind. Aber eben auch wesentlich umständlicher in der Handhabung. Hofstede verdanken wir die grundsätzliche Idee eines Modells, das wir einfach aus der Tasche ziehen können, wenn wir es mal dringend brauchen und etwas interpretieren oder erklären müssen.
Hier
Von 2013 bis 2106 nahmen insgesamt mehr als 235.000 Rennradfahrer an der Festive 500 Challenge von Strava resp. Rapha teil. Im Prinzip ist das eine Absichtserklärung zwischen Weihnachten und Silvester mehr als 500 km zu fahren und dies auf Strava zu dokumentieren. Als Belohnung bekommt man dann nach 500 km und auf Wunsch von Rapha einen kleinen Aufnäher, den man sich irgendwo hinnähen kann und damit zeigt dass man erfolgreich war und zu den Härtesten gehört. Ich hatte bereits einmal darüber geschrieben, wen die Details interessieren. Interessant dabei ist, dass von den 235.000 Teilnehmern nur 197.000, also 84% überhaupt auch nur einen Kilometer auf Strava registrieren und lediglich 45.700 Fahrer oder 19% aller angemeldeten Fahrer es schaffen auch die 500 km zu übertreffen. Man könnte also sagen, von etwa 5 Fahrern die versprechen „Ich fahre jetzt 500 km.“, es weniger als einer schafft sein Versprechen einzulösen.
Da Strava ein soziales Netzwerk der 2. Reihe ist, also es wird nicht als Hauptnetzwerk wie facebook oder whatsapp für die Allgemeinheit genutzt, sondern als ein spezielles Netzwerk für einen Teil der Aktivitäten und Freunde, wird dieses Versprechen öffentlich. Jeder meiner Freunde auf Strava kann sehen, dass ich beabsichtige an der Festive 500 teilnehmen – ich mache also ein Versprechen nach außen. Außerdem ist es auch ein Versprechen nach innen, denn die Zeit im Winter ist eine, in der man nicht besonders viel Lust hat Rad zu fahren, dies aber tun sollte, um die Form nicht zu verlieren. Das ist etwa so wie Abnehmen, oder mit dem Rauchen aufzuhören.
Fühlen nun alle Rennradfahrer die gleiche Verpflichtung ihr Versprechen auch einzuhalten? Ist das denn in jedem Land der Welt so, oder gibt es da deutliche Unterschiede zwischen den Ländern?
Von den 197.000 „aktiven“ Fahrern zwischen 2013 und 2016 (also den Fahrern von den 235.000 gesamt die überhaupt eine Distanz auf Strava melden) kommen etwa 136.000 oder 69% aus lediglich acht Ländern: Den USA (32.500), Großbritannien (31.700), Australien (24.500), Brasilien (16.200), Spanien (9.500), Japan (7.700), Italien (7.100) und Deutschland (6.900). Diese Länder habe ich mir genauer angesehen. In der folgenden Abbildungen kann man sehen, wie viele Fahrer als Anteil der Gesamtheit (also Fahrer die überhaupt gefahren sind) in jedem Land mehr als 500 km gefahren sind.
 Neben dem Land steht zunächst die Anzahl der Teilnehmer. Der Durchschnitt aller betrachteten Länder liegt bei etwa 24%. Man erkennt deutlich die Unterschiede zwischen den Ländern – Spanien, Italien und Brasilien haben im Durchschnitt deutlich weniger erfolgreiche Teilnehmer (etwa halb so viele) wie Japan, Australien und Deutschland. Brasilien und Australien sind hell markiert, weil diese Länder auf der südlichen Halbkugel liegen und es deutlich einfacher ist dort im Dezember 500 km zu fahren, als in der nördlichen Hemisphäre.
Neben dem Land steht zunächst die Anzahl der Teilnehmer. Der Durchschnitt aller betrachteten Länder liegt bei etwa 24%. Man erkennt deutlich die Unterschiede zwischen den Ländern – Spanien, Italien und Brasilien haben im Durchschnitt deutlich weniger erfolgreiche Teilnehmer (etwa halb so viele) wie Japan, Australien und Deutschland. Brasilien und Australien sind hell markiert, weil diese Länder auf der südlichen Halbkugel liegen und es deutlich einfacher ist dort im Dezember 500 km zu fahren, als in der nördlichen Hemisphäre.
Um zu überprüfen, ob es hier einen Zusammenhang mit den Kulturdimensionen nach Hofstede geben könnte, habe ich diese Werte gegen die entsprechenden Landeswerte der sechs Kulturdimensionen (Machtdistanz, Individualismus, Maskulinität, Ungewissheitsvermeidung, Langfristige Ausrichtung und Nachgiebigkeit) geplottet. Vier Mal ist das Ergebnis uninteressant und es gibt keinen erkennbaren Zusammenhang. Auf der anderen Seite gibt es zwei Mal so etwas wie einen Trend, einmal bei der Machtdistanz (Power Distance) und einmal bei der Maskulinität.
 Hier sieht es so aus, als wenn Machtdistanz und Einhalten des „500 km Versprechens“ zusammenhängen: Je geringer die Machtdistanz ist, also je weniger man geneigt ist auszuführen, was einem von oben befohlen wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit sein Versprechen einzulösen. Man könnte das so deuten, dass das Festive 500 Versprechen und dessen Einhaltung aus einem Menschen heraus motiviert ist (intrinisisch, Versprechen nach innen) und nicht von außen aufgezwungen wird (extrinsisch, Versprechen nach außen). Menschen, die sich weniger von außen bestimmen lassen, weisen mehr Disziplin auf ihre eigenen Vorgaben umzusetzen.
Hier sieht es so aus, als wenn Machtdistanz und Einhalten des „500 km Versprechens“ zusammenhängen: Je geringer die Machtdistanz ist, also je weniger man geneigt ist auszuführen, was einem von oben befohlen wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit sein Versprechen einzulösen. Man könnte das so deuten, dass das Festive 500 Versprechen und dessen Einhaltung aus einem Menschen heraus motiviert ist (intrinisisch, Versprechen nach innen) und nicht von außen aufgezwungen wird (extrinsisch, Versprechen nach außen). Menschen, die sich weniger von außen bestimmen lassen, weisen mehr Disziplin auf ihre eigenen Vorgaben umzusetzen.
Ähnlich verhält es sich bei der Maskulinität (MAS). Als feminine Werte zählt Hofstede Fürsorglichkeit, Kooperation und Bescheidenheit auf. Maskuline Werte sind hingegen Konkurrenzbereitschaft und Selbstbewusstsein. Ein hoher MAS-Index weist auf eine Dominanz „typisch männlicher“ Werte, ein niedriger MAS-Wert auf eine Dominanz „typisch weiblicher“ Werte hin.

Wenig überraschend zeigt sich hier ein Zusammenhang. Je eher in einer Kultur maskuline Werte zählen (hoher Index), umso eher werden die 500 km der Festive 500 erreicht. Wobei Japan, mal wieder und wie üblich, nicht in dieses Raster passt. Ich denke es ist ist sehr maskulin öffentlich bekannt zu geben, was man schaffen möchte, in Konkurrenz zu gehen – und dann dies auch zu erfüllen. Alles andere wäre dann eine Blamage. Von daher denke ich, dass dieser Zusammenhang im Wesentlichen durch ein Versprechen nach außen getrieben wird.
Natürlich kann man die Werte auch nicht so einfach miteinander vergleichen. So sind z.B. mehr als 80% der Teilnehmer an der Festive 500 männlich – kein Wunder also, dass im Vergleich zum Durchschnitt eines Landes auch eher maskuline Werte dominieren.
Man kann das alles lang und breit diskutieren und auf die Unzulänglichkeiten der benutzen Modelle, Annahmen und verwendeten Daten verweisen. Was wir nicht wegdiskutieren können ist, dass es in verschiedenen Ländern deutlich verschiedene Wahrscheinlichkeiten gibt 500 km zwischen Weihnachten und Silvester zu fahren. Ein oder zwei Gründe dafür könnten im Modell von Hofstede zu finden sein.
Aber vielleicht liege ich da auch ganz falsch.
Egal wie dem sei, meine Frau näht netterweise gerad den vierten Aufnäher auf mein Langarmjersey.

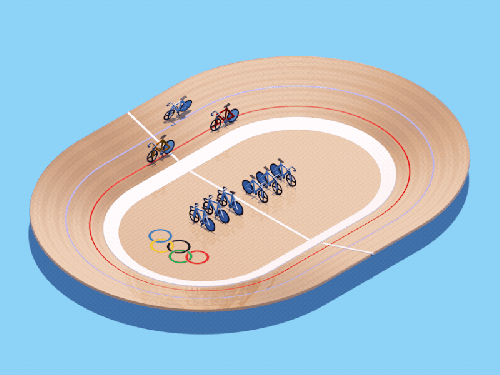



![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/05/dscf2416.jpg?w=500)









![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2015/10/imgp1823.jpg?w=751&h=448)












![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3159.jpg?w=500)


![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3171.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3172.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3173.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3174.jpg?w=500)


![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/04/dscf2330.jpg?w=500&h=819)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3148.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/05/dscf2437.jpg?w=500)

![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3118.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2015/10/imgp1877.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2015/10/imgp1794.jpg?w=619&h=718)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/05/dscf2389.jpg?w=500)
![[IMG]](https://cyclitis.files.wordpress.com/2016/10/dscf3176.jpg?w=500)








































































































































